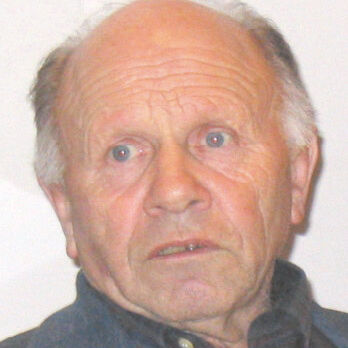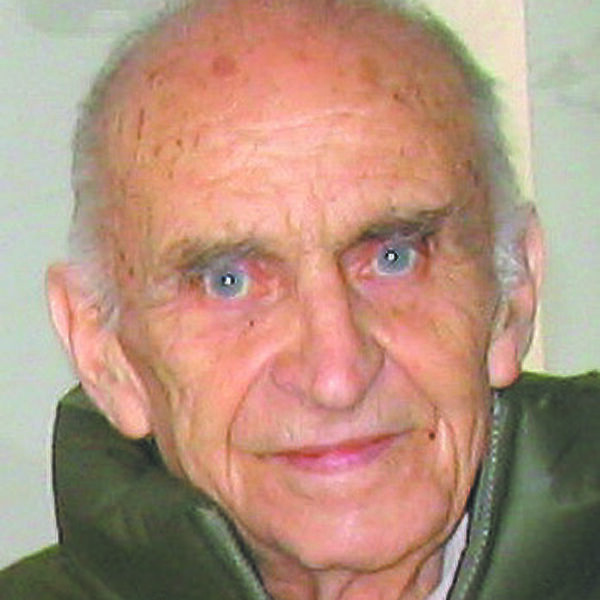Transkript des Audios:
Sprecher: Hildegard Hintz lebte bis 1945 im westpreußischen Danzig, wo sowohl Deutsche als auch Polen wohnten. Ihr Mann trat als Deutscher einer polnischen Gewerkschaft bei, um Arbeit zu finden. Als die Freistadt Danzig 1939 wieder ans Deutsche Reich angeschlossen wurde, nahmen die Nazis die Bevölkerung unter die Lupe. Für die Familie Hintz wurde ihre Verbindung zu Polen zum Nachteil.
Hildegard Hintz: Mein Mann war ja nun arbeitslos geworden, dadurch dass er in dem polnischen Verband war. Am 16. Juli haben wir geheiratet, und am 18. Juli sind wir in unsere Wohnung in die Kolkhoffgasse gezogen. Mein Mann und ich sind in die Kolkhoffgasse gegangen, und in derselben Nacht schellten sie an unserer Tür und ich ging und habe aufgemacht. Es war die Gestapo. Da wollten Sie sehen, die haben irgendwie rausbekommen, wir haben geheiratet und ob Gäste bei uns waren. Da mein Mann im polnischen Verband war, haben Sie geglaubt, dass Polen bei uns zu Gast waren. „Wir wollten nur mal sehen, wie es Ihnen geht und so“, und dann sind sie wieder gegangen, nachts um zwei. Das war meine Hochzeitsnacht.
[Wir haben keine polnischen Verwandten, nur dadurch, dass mein Mann in diesem polnischen Verband war, da waren wir schon derart gekennzeichnet, das, das ... Das reichte schon.
Der Schwiegervater, der hatte auf einem Schlachthof in Danzig gearbeitet und wie das unter Kollegen so ist, da haben die sich mal unterhalten und da hat er irgendeinen negativen Satz gesagt in Bezug auf, ja, die Juden sind auch Menschen oder so, und da hatte jemand ihn deshalb denunziert und da wollten sie ihn auch ... also, da sollte er desertiert [Anmerkung: stehen lassen? oder deportiert draus machen?] werden. Der hat das noch zeitig mitgekriegt, ist nach Polen gegangen, damals. Ja, das war gerade so auf der Kippe, die Tage waren so gezählt. Da ist er nach Polen gegangen und hat gearbeitet, er hat da gearbeitet. Meine Schwiegermutter ist nachgezogen und da waren die vielleicht ein halbes Jahr in Polen, bis der Krieg dann ausbrach.
Ja, die Gestapo kam immer noch bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Mann eingezogen wurde, kamen die immer noch mal nachfragen und mal nachsehen, wie‘s uns ging und ich sollte auch einen äh, Deutschkursus machen. Ich habe das auch nicht verstanden. (...)
Aber, sie sind immer noch gekommen und haben immer gefragt, auch nach den Kindern, und mal geguckt, ob vielleicht Polen zu Besuch waren oder so. Ja, das haben die schon gemacht.
Es waren nicht so die Verhältnisse, wie sie hier sind, dass die Türken in Stadtteilen für sich sind und die Deutschen einen Stadtteil für sich haben. Wir haben das kaum gemerkt, dass da Polen, dass irgendwo mal in einem Haus eine polnische Familie gewohnt hat. Aber, im Grunde genommen haben wir das nicht gemerkt. Aber Juden. Die Juden haben wir dann, Juden waren mehr. Dann haben wir schon mitgekriegt, dass die abgeholt worden. Ja, wir haben das gesehen. Ja, um vier Uhr morgens kam die Gestapo und dann haben sie sie rausgeholt. Wurden sie mitgenommen. Wir haben gar nicht gewagt zu fragen. Wir haben gar nicht gewagt. Jeder wusste, die wurden abgeholt, aber wohin, das wussten wir nicht. Wir wussten nicht, wohin die gebracht wurden und wir haben auch gar nicht gewagt, groß zu fragen. Wir hatten Angst davor, dass wir auch abgeholt wurden. Zuerst wurden die Wohnungen versiegelt und dann wurden andere Familien da reingesetzt. (Der Haushalt) blieb alles so, wie es war, oder es wurde vernichtet. Öffentlich. Bücher, alles zum Fenster rausgeschmissen. Nein, konnte sich keiner was nehmen (lacht). Jeder hatte Angst gehabt was zu nehmen.
Wir haben ganz normal gelebt (mit den Polen und Juden). Wir haben mit allen Leuten guten Kontakt gehabt. Man kann nicht sagen, dass wir zu einem oder zum, zum... es gab größere Geschäfte, die polnische Juden hatten. Wir hatten mit allen guten Kontakten. Die sprachen alle deutsch.]
Sprecher: Als die Front der roten Armee sich der Stadt näherte. Versuchten viele Deutsche diese fluchtartig zu verlassen. Da der Vater von Frau Hintz am Umbau des Kriegsschiffes Willhelm Gustloff zu einem Flüchtlingsschiff beteiligt war, erhielt die Familie Karten für die Ausreise ins Reich. Dort kam das Schiff aber nie an, da es von drei russischen Torpedos versenkt wurde.
Hildegard Hintz: Wir hatten Karten bekommen auf für die Willhelm Gustloff. Zuerst haben wir gesehen wie die Leute sich da gedrängt und fast geschlagen haben, um auf das Schiff zu kommen. Es war unmöglich. Der Gauleiter Forster, von Danzig der Gauleiter, die hatten alle ihre Reichtümer, alles auf die Gustloff gebracht, um das irgendwie zu retten. Da waren Räume zur Verfügung gestellt worden für die Herren, dass die ihre Schätze da unterbringen konnten. Und dann kam ja das Volk. Jetzt waren da nicht genug Karten, die hatten ja nicht alle Karten. Karten hatten nur die Arbeiter bekommen, die auf der Gustloff gearbeitet hatten. Denen hatten Sie Karten gegeben. Und dann waren da vielleicht noch einige höhere von den Parteibonzen und so weiß ich nicht, wer noch Karten bekommen hatte, aber das der Größte Teil, der hatte keine Karten und da hatten die sich angestellt. Es ist nicht zu beschreiben, wie die Leute da mit ihrem Gepäck und mit den Kindern, wie die auf die Gustloff gekommen waren, also es war furchtbar. Und wie die dann voll war, wie die dann nicht mehr genügend Platz hatte, dann sind die restlichen Leute zurückgeblieben. Die haben geweint und geweint und geweint, weil sie nicht auf die Gustloff konnten. Dann ist die Gustloff ausgelaufen und die anderen sind zurückgeblieben. Naja, und was dann mit der Gustloff passierte, das haben wir auch nicht gleich erfahren. Erst nach zwei Wochen oder nach drei haben wir das erst erfahren, das die Gustloff untergegangen ist. Ich hatte eine Freundin, eine junge Frau, die hatten kurz vorher geheiratet, und der ganzen Familie haben wir unsere Karten gegeben. Ja ich habe auch nie wieder was von ihnen gehört. Aber es war gut gemeint, aber es war gut gemeint.
Sprecher: Zwei Monate nach dem Untergang der Wilhelm Gustloff marschierte die rote Armee in Danzig ein. Auch wenn die erste Begegnung mit einem russischen Soldaten nicht furchterregend war, musste sich Hildegard Hintz, damals 26 Jahre alt, mit zahlreichen anderen jungen Mädchen vor den russischen Soldaten verstecken.
Hildegard Hintz: Wir waren alle in der Waschküche unten, und plötzlich geht die Tür auf, und dann kommt ein russischer Offizier rein, sprach sehr gut Deutsch. Fragte wo deutsche Soldaten sind, ob noch deutsche Soldaten da sind. - Nein, es war kein Soldat mehr da. Naja, das war so der erste... die sind ja gar nicht schlimm, nicht, der hat ja nichts gewollt, hat auch nicht gesagt „Uhr. Uhr!“. Keine Uhr wollte er, nichts. Und wie die dann da waren, und sich eingelebt hatten, und eingenistet in das Haus, dann war’s ja lustig. Und dann kamen die Nächte! Und die Russen in dem Gästehaus der Danziger Werft das kann man gar nicht beschreiben, wie das war. Dann kamen die Russen und nahmen dann die jungen Frauen alle mit. Und wie wir die los waren, da waren wir nachher schon n bisschen klüger geworden. Wenn wir dann merkten, die kamen, dann sind wir jungen Frauen die Treppen rauf. Das Haus hatte ein Flachdach, da sind wir aut den Boden, da war eine Luke, und da haben wir eine Leiter genommen, sind wir aufs Dach raufgekletteil, und haben die Leiter hochgezogen, die Luke wieder zu gemacht, und haben uns am Kamin autgehalten. Die ganze Zeit, immer am Kamin gesessen.
Sprecher: der Platz auf dem Dach ihres Hauses wurde über Wochen zum Versteck für frau Hintz. Dort sitzend erfuhr sie auch vom ende des Kriegs am 09. Mais 1945.
Hildegard Hintz: Wir haben auf dem Dach am Schornstein gelegen und die haben geschossen, die haben geschossen wie wahnsinnig, wir haben gedacht „jetzt gibt’s doch nicht mehr zu schießen, warum, wo schießen die jetzt noch“ und dann haben wir erfahren, dass war das Kriegende.
Sprecher: In der großen Furcht vor der roten Armee gab es auch positive Erfahrungen. So erfuhr die Familie davon das in einer Backstube Brot verteilt wurde.
Hildegard Hintz: Ich bin mit meinen Kindern auch gegangen [...] und hab mich angestellt nach Brot. Als ich an die Reihe kam, da kommt einer dieser Soldaten und guckt auf meine kleine Tochter und sagt, „Willst du Brot?“ auf deutsch. „Ja“, sagt sie. Da hat er sie mitgenommen, ist in die Backstube gegangen, am Regal, wo die Brote alle lagen. „Welches willste haben?“ „Das, das, das und das.", sagt sie. Alle gab er ihr [lacht] Alle vier Brote gab er ihr.